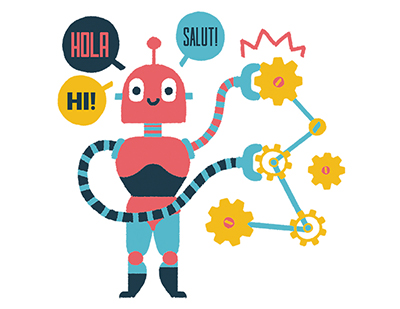Content area
Full text
Berli, Oliver: Grenzenlos guter Geschmack. Die feinen Unterschiede des Musikhörens. Bielefeld: transcript 2014. 296 S., 15 Tabellen, ISBN 978-3-8376-2736-7.
Oliver Berli dokumentiert mit diesem Buch seine Auseinandersetzung mit dem Musikgeschmack, einem Evergreen der sozialwissenschaftlichen Musikforschung. Schon im Untertitel verweist er klar auf seine Hauptreferenz. Pierre Bourdieu hat 1979 mit La distinction den bis dahin eindrucksvollsten Entwurf einer ungleichheitstheoretischen Gesellschaftstheorie auf Basis klassenspezifischer Kulturrezeption vorgelegt.1 Generationen von Kultursoziologen arbeiten sich seither an dieser Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft ab. Gemeinsam mit Howard Beckers "Art Worlds" und Richard Petersons "Production of Culture"-Ansatz entstand hier in Abgrenzung zu musikwissenschaftlichen Traditionen eine eigenständige sozialwissenschaftliche Perspektive auf musikalische Praxis. Mit der ,Entdeckung' der musikalischen Allesfresser hat dieses Feuer noch einmal neue Nahrung bekommen und auch im deutschen Sprachraum intensive Anschlussforschung motiviert. Hier reiht sich nun Berli ein, mit seiner Untersuchung der Distinktions- und Legitimationspraxis von Musikrezipienten. Seine besondere Aufmerksamkeit gilt dem grenzüberschreitenden Musikgeschmack, zu dem er schon 2010 im Band 2 der verdienstvollen, aber kurzlebigen Reihe Werkstatt populäre musik erste Ideen vorgelegt hat. In der Auseinandersetzung mit Omnivorizität und grenzüberschreitendem Konsum - was nicht das gleiche ist - entwickelt er hier eine Theorie des unterscheidenden Hörens und untersucht auf empirischem Wege Praktiken des Ordnens, Praktiken des Legitimierens und Praktiken des Sich-Abgrenzens.
Das Buch präsentiert sich in der bewährten Darstellungsform von Dissertationsprojekten. Zu Beginn erfolgt eine intensive Auseinandersetzung mit dem theoretischen Rahmen. Das sind zuerst natürlich Bourdieus ungleichheitsanalytische Soziologie des Musikgeschmacks und ihre Wurzeln bei Marx...